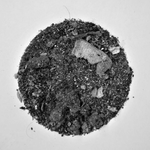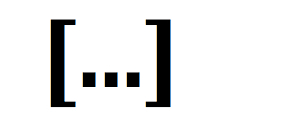Ein Versuch über Schmutz und Film
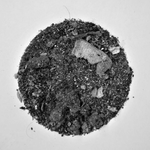 Der dickste Teppich, in dem meine Füße jemals versanken, befindet sich im Logenbereich des Sathyam Cinemas in Chennai. Der Regisseur K. Hariharan, mit dem ich in jenen Tagen viel Zeit in einem viel zu kalten Schneideraum verbrachte, nur unterbrochen von gelegentlicher Suppe und Samosas in der Studioküche, hatte uns zur Premiere von Om Puris neuestem Film, „The Hangman“, eingeladen. In diesem spielt er, worauf der Titel bereits dezent verweist, einen Henker, der im dramatischen Verlauf der fast dreistündigen Handlung seinen einzigen Sohn an die illegalen Verlockungen der Großstadt verliert und am Ende tatsächlich vom Lande her anreisen muss, um selbigen zu hängen, durch den obersten Richter persönlich gerufen, da er der Letzte und Beste seiner Zunft ist. Es wurde jedoch nicht gesungen. Warum fällt mir das gerade jetzt wieder ein? Wahrscheinlich, weil ich kürzlich „Charlie Wilson’s War“ sah, und auch Om Puri wieder, der dort General Muhammad Zia-ul-Haq verkörpert, seines Zeichens Staatsoberhaupt Pakistans von 1977 bis 1988 und emotionaler Joker in Joanne Herrings antikommunistischem Unterfangen, via den texanischen Abgeordneten Charles Nesbitt Wilson unglaublich hohe Geldbeträge im US-amerikanischen Kongress für die Bewaffnung der Mudschahedin freizumachen. Dies kann aus vielen verschiedenen Gründen interessant sein, ist es für mich aber hauptsächlich, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ein Kreis würde sich nachträglich schließen zwischen den stickigen Stätten der indischen Filmindustrie und den kühlen grünen Tälern Afghanistans, die man auf dem Weg dorthin überquert, so man denn von Westen her anreist. Der Teppichboden in der Loge war übrigens fast vom gleichen Rot wie die Polsterbezüge der Air Force One in den 80er Jahren.
Der dickste Teppich, in dem meine Füße jemals versanken, befindet sich im Logenbereich des Sathyam Cinemas in Chennai. Der Regisseur K. Hariharan, mit dem ich in jenen Tagen viel Zeit in einem viel zu kalten Schneideraum verbrachte, nur unterbrochen von gelegentlicher Suppe und Samosas in der Studioküche, hatte uns zur Premiere von Om Puris neuestem Film, „The Hangman“, eingeladen. In diesem spielt er, worauf der Titel bereits dezent verweist, einen Henker, der im dramatischen Verlauf der fast dreistündigen Handlung seinen einzigen Sohn an die illegalen Verlockungen der Großstadt verliert und am Ende tatsächlich vom Lande her anreisen muss, um selbigen zu hängen, durch den obersten Richter persönlich gerufen, da er der Letzte und Beste seiner Zunft ist. Es wurde jedoch nicht gesungen. Warum fällt mir das gerade jetzt wieder ein? Wahrscheinlich, weil ich kürzlich „Charlie Wilson’s War“ sah, und auch Om Puri wieder, der dort General Muhammad Zia-ul-Haq verkörpert, seines Zeichens Staatsoberhaupt Pakistans von 1977 bis 1988 und emotionaler Joker in Joanne Herrings antikommunistischem Unterfangen, via den texanischen Abgeordneten Charles Nesbitt Wilson unglaublich hohe Geldbeträge im US-amerikanischen Kongress für die Bewaffnung der Mudschahedin freizumachen. Dies kann aus vielen verschiedenen Gründen interessant sein, ist es für mich aber hauptsächlich, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ein Kreis würde sich nachträglich schließen zwischen den stickigen Stätten der indischen Filmindustrie und den kühlen grünen Tälern Afghanistans, die man auf dem Weg dorthin überquert, so man denn von Westen her anreist. Der Teppichboden in der Loge war übrigens fast vom gleichen Rot wie die Polsterbezüge der Air Force One in den 80er Jahren.
Sie fragen sich nun, lieber Leser, was dies wohl mit Schmutz zu tun haben soll, insbesondere mit Schmutz im Film, und Sie stellen sich diese Frage zurecht. Zunächst einmal nämlich gar nichts, es sei denn, man würde die ausgelatschten metaphorischen Pfade betreten wollen, auf denen alles mit allem zu tun hat und beispielsweise ein blitzsauberer flauschiger Teppich in einem indischen Großstadtkino nicht nur als Aufhänger für einen bemühten Diskurs zur Dialektik des Einschließens und Ausschließens, der Abgrenzung und des Einbezugs dienen könnte, sondern zugleich auch noch hinzeigt zu den tausend Plateaus, auf, unter und zwischen denen alle Dinge, Menschen und Ereignisse miteinander verknüpft und verwoben sind. Ein wenig esoterisch, nicht wahr?
Andererseits jedoch tatsächlich auch irgendwie – wahr. Denn der Begriff des Schmutzes hat immer auch mit der Sehnsucht nach Reinheit zu tun. Mit dem Guten und dem Schlechten. Mit dem, was man will und dem, was man nicht will. Der Schmutz ist also zunächst einmal per definitionem das, was nicht zu wollen ist, das Ausgeschlossene, das weg muss und bestimmt somit aber zugleich das Gute, Wahre, Schöne, also eben das, was sehr wohl zu wollen ist und in der Welt sein und auch bleiben soll. Der Begriff, mit dem wir es zu tun haben, ist folglich einer der Ausgrenzung, der zugleich immer auch dialektisch der Bestimmung dessen dient, zu dem er nicht gehören soll. Am Notausgang links sehen wir kurz Michel Foucault winken, bevor er leise den Saal verlässt. Popcorn holen, wahrscheinlich.
[…]
Ganzen Artikel anzeigen