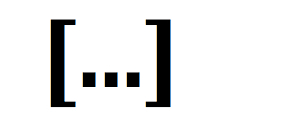Das Unerzählbare erzählen
Anfang 2015 lud Thomas von Steinaecker neun Kollegen dazu ein, mit ihm gemeinsam in einem Online-Erzählprojekt der realen Geschichte zweier junger Frauen, die sich dem IS in Syrien angeschlossen haben, nachzuspüren. Drei Wochen lang schrieben die Autoren Erzählkapitel und diskutierten über Traditionen politischen Schreibens, moralischen Anspruch und Grenzen von Literatur. Diese Fragen, respektive diejenige danach, was das Erzählen heutzutage sein kann (und sein soll?), ziehen sich gewissermaßen als roter Faden durch die Arbeiten des Autors.
Bereits sein Debüt Wallner beginnt zu fliegen hinterfragt, wie wir unsere Lebenswirklichkeit wahrnehmen – und wie damit umzugehen ist, wenn sich die Grenzen dessen, was wir als „real“ erfahren, verschieben und auflösen. Der Text dreht die klassische Blickrichtung des Familienromans um und gibt jeder der drei beteiligten Generationen ihre eigene Sprache. Doch welche dieser Erzählungen bildet es nun ab, das „wahre Leben“? Erinnerung und Lüge, Story und Legende, Realität und Fiktion werden ununterscheidbar.
Thomas von Steinaeckers zweiter Roman Geister lotet diese Thematik noch weiter aus und lässt seine Protagonisten im Grenzgebiet zwischen Realität, Tagtraum, Gedankenspiel und Parallelwelt umherwandeln. So erzählt der Text von einer Gesellschaft, die ständig neue Bilder und Versionen der eigenen Lebenswelt produziert und verweist bereits 2008 auf unsere Inszenierungen in den sozialen Netzwerken.
[…]
Auch der dritte Roman Schutzgebiet ist eine Variante der Überlegung, wie Formexperiment, unterhaltendes Erzählen und die ernsthafte Frage nach unserer Wirklichkeit zusammengehen können. Das Buch wimmelt von subtil eingeflochtenen Zitaten, wörtlichen oder motivischen, was eine doppelte Lesart ermöglicht: einmal als Abenteuerroman, zum anderen als ständiges Spiel mit literarischen Vorbildern.
Im Zentrum von Roman Nr. 4 – Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen, und anfing zu träumen – steht die Uneindeutigkeit darüber, wo die Realität aufhört und der Wahn beginnt. Zwar tut der Text so, als würde er psychologisch-realistisch erzählen, ist jedoch eigentlich auf völlig schwankendem Boden gebaut, denn er ist durchsetzt mit Fotos, Zeichnungen und Tabellen, die nichts illustrieren, sondern vielmehr eine Irritation darüber auslösen, was mit ihnen belegt werden soll, auf welche Realität sie überhaupt verweisen.
In seinem jüngsten Roman nun verdichtet von Steinaecker Reflexion und Formexperiment noch stringenter und stellt besagte zentrale Fragen dezidiert politisch und philosophisch: Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Und wer ist überhaupt „wir“? Und wie kann davon erzählt werden?
Die Bühne, auf der dies verhandelt wird, ist ein postapokalyptisches Deutschland. Die Gewässer sind verseucht, und am Himmel kreisen Drohnen, die einstmals Care-Pakete abwarfen, jetzt aber gezielt Schüsse abfeuern. Banden und Mutanten ziehen umher. Hier lebt der fünfzehnjährige Heinz, der „ein guter Mensch sein möchte“, zusammen mit einigen anderen Überlebenden, die eine Gemeinschaft bilden.
Jemand schenkt Heinz Papier und Stifte, damit er die Geschichte der Gemeinschaft aufschreiben kann. Er wird zum Chronisten, sammelt „Altwörter“ und Traditionen, mittlerweile fast obsolete Begriffe wie „Höflichkeit“ und „Würde“, die die Gemeinschaft von „den Barbaren da draußen“ unterscheiden. Doch was zunächst wohlgemut beginnt und vom Humanen erzählt, wird bald zu einem Bericht von Grausamkeit, Wahnsinn und Schrecken. Die Grenzen zwischen Mensch, Barbar, Tier und Mutant scheinen sich aufzulösen.
Und so muss sich Heinz (und der Leser mit ihm) fragen, was denn der Mensch eigentlich ist in einer Zeit, in der er körperlich und geistig neu definiert werden muss, und deren humanistische Werte aus dem vorvorletzten Jahrhundert stammen? Und was schließlich ist dieses Paradies, das es zu verteidigen gilt: die Zivilisation, die Menschlichkeit, die Seele, die Kunst? Ein kluges Buch, das aus der Zukunft heraus über unsere Gegenwart spricht.
Thomas von Steinaecker: Die Verteidigung des Paradieses, S. Fischer 2016.
Erschienen in: der Freitag 10 / 2016, S. 25