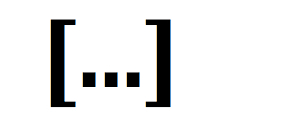Denn alle Lust will
Durch das Fenster des Flugzeuges sah man die uralten Länder sich ausbreiten, unter deren Sand kein Königreich mehr zu finden ist. Die milchigen, hellblauen Seen zwischen Quadratkilometern gelben und braunen Ödlandes, unter deren Oberfläche die Strömung Muster in den sandigen Grund zeichnet, Richtungsfelder, die nur von oben zu sehen sind, große Pfeile ohne Magnet. Auf den dunkleren Bergzügen weitläufige, sich verästelnde Wege, kleine Siedlungen miteinander verbindend oder ins Nichts führend, verschwindend in dunklen Schluchten oder in der sich plötzlich auftuenden Weite der großen Wüste. Später die kühlen, grünen Täler, Rücken riesiger, ewig schlafender Tiere, in Granit gekauert. Dann Nacht, der ausglimmenden Dämmerung in 10.000 Meter Höhe folgend, am gekrümmten Schnittpunkt zwischen Atmosphäre und Unendlichkeit.
Ich verließ die Abfertigungshalle in der Nacht und sowohl der Fahrer als auch sein Assistent hatten nicht mehr als eine ungefähre Ahnung von dem Ort, an den ich zu bringen sei. So fuhren wir lange Stunden durch die leeren staubigen Straßen, an vereinzelten Polizisten vorbei, die in verschiedene Richtungen wiesen, um schließlich doch, durch Zufall natürlich, das zurückgesetzte dunkle Haus zu finden, hinter bewachsenen Mauern, umschmiegt von großen Bäumen. Am Nachbargebäude zierten große goldene Swastiken die Balkone, glitzernd im schwankenden Licht der Laternen.
Das Appartement teile ich mir mit einem Mädchen nie gehörten Namens. Ich sitze in dem unglaublich großen Wohnzimmer an einem viel zu kleinen Sekretär, auf einem viel zu niedrigen Stuhl. Durch die vergitterten, weiß gestrichenen Fenster ragen beinahe die Palmen herein; zwischen angegilbten Zweigen die Straße, überflutet von braunem Wasser. An der Toreinfahrt stehen ratlose Frauen, die Hände an den Säumen ihrer Saris, unentschlossen, die Fluten zu durchqueren. Ein grauhaariger Mann steigt auf sein Fahrrad und fährt zum trockenen Mittelstreifen. Hinten, in der Küche, verkocht der Reis und rechts singt Thom Yorke aus kleinen schwarzen Boxen. Auf dem Sekretär steht ein illustrierter Abreißkalender, der auf gelblichem Grund zwei verschiedenartige Hunde und einen angeschnittenen Gugelhupf zeigt. Durch die Bäume huschen Eichhörnchen, die wie Ratten aussehen. Ratten mit buschigem Schwanz.
In einer Schublade fand ich ein Photo, auf dem ist eine hübsche Amerikanerin zu sehen. Sie sitzt auf einem Bett, in einem chinesischen Hotelzimmer. Ich weiß, wo dieses Hotel steht, kenne seine Betten und Webstoffe, die bronzenen Armaturen, mit denen nichts mehr zu regeln ist, kein Radio und keine Lüftung, kenne die Treppenhäuser und den kleinen Raum der Etagenwächterin, die Plastikbehältnisse und die gelblich schimmernden Wäschehaufen, kenne die Blicke aus den Fenstern, den metallenen Handwagen und das Fleisch, das er trägt, den Rauch, der sich meterhoch in die selten kalten Nächte erhebt, noch weit hinaus über die Bäume und Gebäude, wie ein großer weißer Vorschlag, wie ein unbefangener Gruß. Ich weiß, dass man nicht weit gehen muss, den See zu sehen. Die farbigen Neongründe, in die er sich schon zur Dämmerung hüllt, sind mir wohl bekannt. Sie spricht die Sprache des Landes, die hübsche Amerikanerin, und bestimmt sind ihre Fußsohlen weich wie Hasenfell, ihre Zähne scharf wie Zollkontrollen. Wie ein dunkler Gedanke verspürte ich den Wunsch, mit ihr auf den Grund der tiefsten Schlucht des Landes zu stoßen, weitab der geführten Gruppen und der Plastikstühle. Die Zungen der Schweine schmecken sehr gut, in diesem Teil des Staates.
[…]
Am Abend hallt die ganze Straße wider vom Geschrei der Raben. Mit der Dämmerung sind sie gekommen, die schweren schwarzen Vögel, unangekündigt und in Scharen. Sie flattern im Gewächs umher und hocken auf den Zaunspitzen. Große dunkle Schatten vor dem ausglimmenden Himmel und dem Scherenschnitt der umstehenden Häuser. Ihr kehliges Schreien klingt aufgeregt, als ob sie jemanden suchten. Als die Nacht sich vollends über die Stadt gelegt hat, sind sie verschwunden. Auf der immer noch überfluteten Straße fahren vereinzelte Autos wie unförmige Boote vorüber, ihre Scheinwerfer reißen die glatte Fläche des Wassers aus der Finsternis, kurz bevor sie von den Reifen zerschnitten wird und für einen langen Augenblick jegliche Unschuld verliert.
Ich träume immer öfter von nordischen Ländern. Vom Knarren der Eisschollen, die sich aneinander reiben. Vom Weiß, vom Blau und vom Schwarz. Vom Wasser in all seinen Formen. Zug um Zug. Immer weiter nach oben, bis Tag und Nacht verschwimmen.
Am Fuße der Tempel krümmt sich die Zeit zusammen. Man kann es sehen, selbst von hier noch. Unverschuldete Dummheit baut sich naturgemäße Behausungen, alles geht seinen Gang, keiner verlässt seinen Platz. Hinten rechts, am Krähenbaum vorbei, preist der Muezzin die Großartigkeit eines einzigen Gottes und auch die der modernen Tontechnik. Rascheln im Gestrüpp. Schreibgeschützte Stimmbänder. Das Paradigmatische aller Medien. In der Baugrube, unten, Richtung Meer, sitzen aus Bergdörfern importierte Handwerksfamilien und trinken bräunliche Milch statt Brühe. Weiter die Küste hinauf gibt es ebenfalls Verbrennungsstätten. Nahe des nachts stroboskopierenden Leuchtturms. Seit Tagen schon zuckt mein linkes Augenlid, wenn der Abend kommt. Die Luft auf diesem Dach jedoch wird sanft wie Seide, mit der Dämmerung. Bis dato hat mir noch niemand hier Komplimente bezüglich der Leistungen Adolf Hitlers ausgesprochen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Bei Fahrten durch indische Städte sollte man ausschließlich „Karma Police“ hören.
Auf dem Dachgiebel gegenüber sitzt eine Walküre, scherenschnittig vor vollem Mond; mit teigigem Finger zeigt sie beinahe träge umher und wird so lässig über den niederfallenden Passanten thronend ihrem zusammengesetzten Namen spielerisch aber gut aussehend, problemlos sozusagen, gerecht.
In Mamallapuram, dem uralten Steinmetzdorf südlich der Stadt, gab es einmal sieben Tempel, die direkt an der Küste standen. Das Meer hat sich sechs von ihnen geholt, über die Jahrhunderte. Nur einer ist übrig geblieben und fristet nun ein einsames Dasein als eines der meistphotographierten Bauwerke Indiens. Als der Tsunami kam und das Meer weit zurück sog, nach draußen, wie ein überdimensionaler Mond, konnte der Tempelwächter ungläubigen Blickes in der weiten Kraterlandschaft, die sich plötzlich vor ihm auftat, die Reste der sechs verschwundenen Tempel ausmachen, von Schlick und Getier überzogen, Heimstatt für die Fische. Bevor die Fluten zurückkamen, den Tempelwächter hinweg spülten und auch den siebten Tempel zu einer Ruine werden ließen.
Immer wieder habe ich Blut an den Fingern, von dem niemand sagen kann, wo es herkommt. Ganz frei von Metaphorit. Kleine Schnittwunden, aufgeplatzte Knöchel, hingerissene Haut. Vom Papier wahrscheinlich, selbstverständlich, von den vielen beiseite geschobenen Ideen. Vom Abhalten der Rechnungen und der Vorträge. Oder doch von den zu fest eingeschlagenen Wegen. In Packpapier, polsternd, watteweich, was weiß ich? Mein Brustkorb ist hohl, meine Haut aus Plastik, glänzend. Ab und zu öffnet sich eine Klappe, rechts oder links, wenn ich mich nicht bewege, und ein kleiner weißer Knetmassenhase schaut heraus, mit einer roten, runden Nase und dunklen Knopfaugen. Er blickt umher und versucht etwas zu wittern, wohl. Wenn ich ganz still halte, kommt er vollends heraus und geht ein wenig umher, aufrecht, auf seinen Hinterläufen. Doch nicht für lange, bald klettert er wieder hinein, verschließt die Klappe hinter sich, die ich nicht öffnen kann und umschließt mit seinen Pfötchen den Griff der altmodischen Wasserpumpe, mittels der er rote Flüssigkeit durch Schläuche drückt. Seine langen Ohren wippen im Takt der Bewegung und sein Blick geht ins Leere. Ich hingegen liege da, wie einer von Josef Winklers Leichnamen, den Kopf leicht erhöht und die Hände auf der Brust gefaltet. Das Brennen auf den Wangen lässt kurz nach und vielleicht kann ich schlafen dann, für ein oder zwei Stunden.
Was ich immer wieder gerne tue: Zerrissene Zettel aufheben, an Grabsteinen schnüffeln, in den Abfallcontainern der Krankenhauskrematorien verlorene Hände oder Herzen suchen, die sich nach ihren Körpern sehnen, so oder so aber nicht zurück können. Entweder sind sie selbst die größte Fehlstelle, als Geister im neuronalen Netz, oder der Körper, zu dem sie einst gehörten ist es, in den Leben derer, die ihn vermissen. Die Leute schmeißen einfach zu wenig weg. Der Ersatz, die Obsession des Ersatzes und der Rekonstruktion, ist nichts anderes als die größte Herausstellung des Verlustes, der Abwesenheit. Trotzdem kann man etwas mit ihnen tun, in der Welt, mit den Prothesen unserer postmodernen Sehnsüchte.
Vor ein paar Tagen, vielleicht auch vor ein paar Stunden – auch hier jedenfalls Licht und bedrucktes Papier und Zeit – flog eine mittelgroße Fledermaus zur offenen Verandatüre herein. Sie war ganz schwer von Bedeutung und noch verschreckter als ich, ihre Bewegungen erschienen unbedacht. Lesbarkeit jedenfalls war nicht das ihre und doch konnte ich jeden ihrer Kreise und jede ihrer Ellipsen deuten, wedelte dann mit einem asiatischen T-Shirt nach ihr. Erst zu spät sah ich das Möbiusband, das von ihren Krallen hing wie eine verlangsamte Schleife aus Sehnsucht. Ohne wirklich zu wissen wonach. Eine Etage weiter oben Klopfgeräusche, eine weiter unten Blumenguss. Seine letzte Varianz hier brachte den Flughund wieder durch die Türe und ich kann mir gut vorstellen, dass es im gleichen Moment anfing zu regnen. Auch wenn es dies nicht tat.
Die Träume werden anders: Ein Affe fasst an den Rock eines japanischen Mädchens, zaghaft, berührt sanft den weißen Stoff, den Saum, die Nähte, die linke Hand des japanischen Mädchens bewegt sich, winkelt sich zierlich ab, der Affe schürzt die Lippen. Zwischen Bügelfalten helles Schenkelfleisch. Die schwarz behaarten Hände (Hände?) des Affen, die krummen Finger, das Berühren der Symbole, die Hoffnung, etwas begreifen zu können. Erkennen und benennen, erneut. Immer wieder. Glauben Sie denn, dass irgendetwas von uns übrig bleiben wird? Die Hoffnung ist ein armes Tier. Die schwarzen Haare dann, am Fenster, ein Swimmingpool in der Nacht, erleuchtetes Wasser, die feste Haut der Asiaten. Auf den Fluren der Hotels spielen Katzenkinder im tiefen Flor. Am Lack der Türen schlagen sich Knöchel wund. Unter den Zimmerdecken der Duft der warmen Haut. Unter dem Duft der warmen Haut die Idee der Unsterblichkeit. Ich habe niemals Menschenfleisch gegessen.
Dass diese Reise natürlich nun, wie jede andere auch, ein Versprechen ist, das sich selbst nicht halten kann. Und dass all das, von dem man denkt, es läge fern vom Selbst, dies natürlich nicht im Geringsten tut. Es gibt keine Welt, dort draußen, außerhalb unserer lahmen Organe, die alle Ich sagen wollen, ohne es zu können. Außerhalb dieses Systems biologischer Notwendigkeit, das glaubt, etwas zu sein. Das glaubt, ein Recht auf Glück zu haben, auf Berührungen, auf Küsse und auf Leben. Und das von der Gewissheit träumt, dass jemand sein Herz wie eine Hand halten könnte und es nie wieder loslassen wollte. Wie ein kleines, lebloses Plüschtier. Wie eine Horde wilder Affen. Wie ein Schwan mit Luftgewehr. In der Einflugschneise, die der Bebauungsplan vorgibt, reihen sich die Raben aneinander, üben sich im Formationsflug und rauschen als schwarze, gefiederte Masse beinahe in Griffweite an der Veranda vorbei. In waagerechter Abfolge wie Schlachtvieh, das noch nichts von seinem Ende ahnt. Der Mensch ist das einzige Säugetier, das sich seiner Sterblichkeit bewusst ist.
Ich habe dich gesehen, schließlich, in diesem Zimmer, gegenüber, ich weiß, was du getan hast, die Vorhänge ließen einen Spalt frei, es war nicht dunkel genug. Ich habe die Kamera gesehen und deine Beine, den Stoff und die Bewegungen. Deinen Mund. Deine Hände. Die Bettdecke, wie ein zusammengekauertes Tier auf dem Boden. Die herunterhängenden Reste. Die kleinen Flecken auf deiner Haut. Die Farben. Den Restlichtverstärker. Die Meerjungfrauen an der Wand. Die verblichene Plastikfigur. Die beendeten Träume. Die schwankenden Muskeln. Die heraufbeschworene Klarheit. Alle verfügbaren Artikel. Ganz am Ende dann: deine Augen. Zitterndes Material. Wie weit so ein Herz doch schlagen kann.
Aber man hat schon alles gesagt, ja, natürlich. Lebt aber trotzdem noch und weiß nicht, wie anders. Wie anders man sein könnte, wie anders man sehen könnte, sich, und die Dinge und die Welt. Durch Wiederholung erst entsteht Kultur, ja, aber was bitte soll das denn sein? Dieses unglaublich andere jedenfalls, dort draußen, außerhalb von mir, ist unverständlich aber schreibt sich ein, zweifelsohne, gräbt Zeichen, die vollkommen wertlos sind, für mich, legt seinen öligen Film auf meine Poren. Kürzlich erzählte mir jemand von den Parsi und von ihren Türmen, in die sie die Toten legten, mitten in der Stadt – noch vor ein paar Jahren sei es keine Seltenheit gewesen, dass ein Geier auf der Veranda saß, einen menschlichen Arm im Schnabel, oder sonst ein Organ. Seinen Dienst verrichtend, die Überreste des Lebens, eines Lebens, in alle Himmelsrichtungen verteilend – welch schöne Auffassung von Metaphorik und Repräsentanz. Aber, bitte, kann mir jemand sagen, wer sich eigentlich diesen Scherz ausgedacht hat, diese zeitlose Installation aus Sehnsucht und Wollen? Aus Begehren und Träumen? Und niemand wage es zu sagen, er sei besser als andere. Niemand wage es, glücklich sein zu wollen. Ich glaube, im Inneren aller Prozessoren und auch sämtlicher Wünsche herrscht eine konstante Temperatur von 66,6 Grad Celsius.
Zu viele dieser Worte habe ich schon verwendet, als dass ich noch daran glauben könnte, zu viele dieser aufrichtigen Gefühle verschwendet, als dass man sie einzigartig nennen darf, zu viele Kerzen um die Häuser getragen, um manche Richtigkeit zu bezweifeln. Und doch scheint es manchmal, als ob aus all dem Unnützen ein neues Wissen entsteht, das in seiner Unklarheit Normalität beherbergt, eine relative, und doch niemals neu sein kann. Die Theorie des Bekannten ist obsolet, und manch einer muss viel Geld einzahlen, in die Fremdwörterkasse. Schreibblockade, sagte ich, Abwesenheit meinte ich, eingeschlafene Stille, machtloses Wissen ohne Kraft. Ein „oder“ scheint es nicht mehr zu geben, die Alternativen machen Urlaub, unsere Verkommenheit ist Tatsache. Was hilft? Sind alle Möglichkeiten verbraucht, die ohne Aufgabe unserer täglichen Festungen bestehen könnten? Können wir noch neu sein, glänzend und schön? Eine Zigarette für die Unwissenheit, ein Glas auf die verbrauchte Klarheit. Gehe niemals sanften Herzens in die Nacht hinaus.
Ich möchte meinen Hals schützen, vor der Welt. Dieses mutige Verbindungsstück zwischen unten und oben, zwischen Leib und Seele. Darum lege ich meinen Schal nie ab, es sei denn, deine [die] schlanken blauen Finger [der Frauen] wollen meinen Herzschlag fühlen, kurz unterhalb des Kiefers. Und meinetwegen verweilen dort, bis das Blut aufhört zu fließen.
Vor Tagen schon habe ich mich in etwas verwandelt, das ich im Spiegel nicht mehr erkenne. Ich gehe hinaus, auf die Straßen, in die Welt und ihre Zimmer, ich rede, versuche zu lachen, arbeite. Drücke Menschen die Hand und sehe sie an. Was sie sehen, kann ich nicht sagen, was ich sehe, sagte ich schon.
Die eigentliche Kunst aber ist ja immer das Weglassen. Und deshalb lasse ich mich weg, nun, final und letztgültig. Schauen Sie gut hin, schauen Sie zu, fast schon bin ich nicht mehr zu sehen. Nur Dunkelheit noch und vereinzelt Formen, Stille dann. Draußen vor den Luken das nichtswürdige Brabbeln der Welt.
Erschienen in: LICHTUNGEN 126 / XXXII. Jahrgang