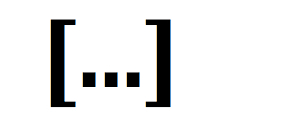Meta, Meta, Meta für Meter
Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ und die Freuden der Referenz
Was also ist noch zu sagen? Cannes bereitet sich schon wieder aufs nächste Jahr vor, alle Weltpremieren sind gelaufen – die Kuh ist also nicht nur längst durchs Dorf getrieben worden, sie steht sogar bereits wieder draußen auf der Weide, angebunden an einen Kübelwagen, wenn mich mein Feldstecher nicht täuscht. Trotzdem: Ein paar Dinge sind vielleicht noch zu erwähnen, zusätzlich zu der wirklich unglaublichen Großartigkeit von Christoph Waltz, der es schafft, noch weit über die ohnehin nahtlos wunderbare Besetzung herauszuragen. Selbst Til Schweiger, der natürlich nur wieder Til Schweiger spielt, und größtenteils stumm guckt, wie er nun mal guckt, funktioniert hier bestens als Teil der Gesamtkomposition. Ähnliches lässt sich über Diane Kruger sagen, wenn auch unter leicht anderen Voraussetzungen und mit mehr Text.
Einige Fußnoten also. Wir wissen: „Inglourious Basterds“ ist ein Film über das Kino. Wollte man eine sehr gewagte These aufstellen, könnte man sogar behaupten, er sei Tarantinos „Le Mépris“. Selbstverständlich ist Tarantino mitnichten Godard, doch trotzdem haben wir es hier mit seiner bisher offensichtlichsten Liebeserklärung an das Kino zu tun, und das will etwas heißen bei jemandem, dessen bevorzugtes künstlerisches Mittel ohnehin das Spiel mit cineastischen Referenzen ist. Dies beginnt bereits mit dem Titel, der, in minimal geänderter Schreibweise, auf die englische Übersetzung von Enzo G. Castellaris „Quel maledetto treno blindato“ aus dem Jahre 1978 verweist. Im Deutschen wiederum heißt er „Ein Haufen verwegener Hunde“, was in diversen Feuilleton-Artikeln über die „Basterds“ zu Referenz-Verwechslungen mit Robert Aldrichs „Das dreckige Dutzend“ von 1967 führte.
Dieser hat jedoch, als großzügig finanzierte Hollywoodproduktion, abgesehen von dem Motiv der aus Außenseitern bestehenden Soldatentruppe, die im zweiten Weltkrieg ein Himmelfahrtskommando durchführen muss, recht wenig mit Castellaris europäischem Exploitationwerk zu tun. Jenes nämlich ist unglaublich campy und somit ein wahrer Freudenquell der halbironischen Kinorezeption. Vor allem ist hier der Aspekt der Sprache zu erwähnen, da sämtliche deutschsprachigen Rollen mit Schauspielern besetzt wurden, die der Sprache gar nicht mächtig sind, jedoch wie selbstverständlich radebrechend deutsche Sätze aus dem Skript aufsagen, was insbesondere für den Hauptdarsteller Bo Svenson gilt. Schon allein deshalb sollte man diesen Film also unbedingt im Original schauen.
[…]
Dies gilt natürlich umso mehr für die „Basterds“, jedoch aus anderen Gründen. Hier nämlich ist der Einsatz verschiedener Sprachen ein tragendes Stilmittel, am signifikantesten bei Christoph Waltz’ Rolle des SS-Oberst Hans Landa zu sehen, der mit dem Wechsel verschiedener Idiome ebenso wenig Probleme hat wie mit der freudigen Zelebrierung eines geradezu selbstverliebten Sadismus, der eben gerade auch immer wieder über das Medium der Sprache zum Tragen kommt und so, was Souveränität und Eloquenz des Bösen angeht, einen ganz eigenen neuen Maßstab setzt. Tarantinos Feuerwerk der Referenzen findet natürlich auch auf allen anderen Ebenen und immer wieder anders statt. Sei es das Streichorchester, das „The Green Leaves of Summer“ spielt (das Thema aus dem Western „The Alamo“), sei es, dass im Pariser Kino von Shoshanna, die Landa in der Eingangssequenz quasi aus Sportsgeist entkommen lässt, G.W. Pabsts „Die weiße Hölle vom Piz Palü“ läuft; bis hin zu Joseph Goebbels und seinen cineastischen Ambitionen, gespielt mit wunderbar rheinischem Dialekt von Sylvester Groth – immer wieder ist es das Kino, das spricht und von dem gesprochen wird.
Und so taucht natürlich auch Enzo G. Castellari kurz im Hintergrund auf, im Foyer der Filmpremiere zu „Stolz der Nation“, dem Film im Film, ebenso wie der erwähnte sprachbegabte Akteur Bo Svenson. Der engagierte Filmwissenschaftler wird auch beim zehnten Durchgang noch derartige Details finden, wie beispielsweise den ubiquitären Bela B., der ungefähr eine Sekunde lang als Kartenabreißer zu sehen ist. Oder die simulierten Filme, die die fiktive Bridget von Hammersmark und die reale Zarah Leander auf einem Plakat zusammenbringen. Unabhängig von diesen cinephilen Freuden jedoch hat man es hier schlicht mit einem ganz wunderbaren und somit leider seltenen Stück Entertainment zu tun, das wir hiermit vorbehaltlos empfehlen möchten.
Erschienen in: OPAK #3 / 2009. Ein PDF des Artikels findet sich hier (S. 60)