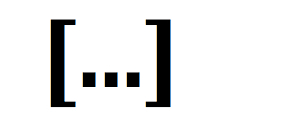Drei Arten Dreck
Ein Versuch über Schmutz und Film
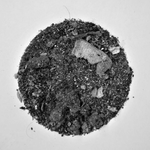 Der dickste Teppich, in dem meine Füße jemals versanken, befindet sich im Logenbereich des Sathyam Cinemas in Chennai. Der Regisseur K. Hariharan, mit dem ich in jenen Tagen viel Zeit in einem viel zu kalten Schneideraum verbrachte, nur unterbrochen von gelegentlicher Suppe und Samosas in der Studioküche, hatte uns zur Premiere von Om Puris neuestem Film, „The Hangman“, eingeladen. In diesem spielt er, worauf der Titel bereits dezent verweist, einen Henker, der im dramatischen Verlauf der fast dreistündigen Handlung seinen einzigen Sohn an die illegalen Verlockungen der Großstadt verliert und am Ende tatsächlich vom Lande her anreisen muss, um selbigen zu hängen, durch den obersten Richter persönlich gerufen, da er der Letzte und Beste seiner Zunft ist. Es wurde jedoch nicht gesungen. Warum fällt mir das gerade jetzt wieder ein? Wahrscheinlich, weil ich kürzlich „Charlie Wilson’s War“ sah, und auch Om Puri wieder, der dort General Muhammad Zia-ul-Haq verkörpert, seines Zeichens Staatsoberhaupt Pakistans von 1977 bis 1988 und emotionaler Joker in Joanne Herrings antikommunistischem Unterfangen, via den texanischen Abgeordneten Charles Nesbitt Wilson unglaublich hohe Geldbeträge im US-amerikanischen Kongress für die Bewaffnung der Mudschahedin freizumachen. Dies kann aus vielen verschiedenen Gründen interessant sein, ist es für mich aber hauptsächlich, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ein Kreis würde sich nachträglich schließen zwischen den stickigen Stätten der indischen Filmindustrie und den kühlen grünen Tälern Afghanistans, die man auf dem Weg dorthin überquert, so man denn von Westen her anreist. Der Teppichboden in der Loge war übrigens fast vom gleichen Rot wie die Polsterbezüge der Air Force One in den 80er Jahren.
Der dickste Teppich, in dem meine Füße jemals versanken, befindet sich im Logenbereich des Sathyam Cinemas in Chennai. Der Regisseur K. Hariharan, mit dem ich in jenen Tagen viel Zeit in einem viel zu kalten Schneideraum verbrachte, nur unterbrochen von gelegentlicher Suppe und Samosas in der Studioküche, hatte uns zur Premiere von Om Puris neuestem Film, „The Hangman“, eingeladen. In diesem spielt er, worauf der Titel bereits dezent verweist, einen Henker, der im dramatischen Verlauf der fast dreistündigen Handlung seinen einzigen Sohn an die illegalen Verlockungen der Großstadt verliert und am Ende tatsächlich vom Lande her anreisen muss, um selbigen zu hängen, durch den obersten Richter persönlich gerufen, da er der Letzte und Beste seiner Zunft ist. Es wurde jedoch nicht gesungen. Warum fällt mir das gerade jetzt wieder ein? Wahrscheinlich, weil ich kürzlich „Charlie Wilson’s War“ sah, und auch Om Puri wieder, der dort General Muhammad Zia-ul-Haq verkörpert, seines Zeichens Staatsoberhaupt Pakistans von 1977 bis 1988 und emotionaler Joker in Joanne Herrings antikommunistischem Unterfangen, via den texanischen Abgeordneten Charles Nesbitt Wilson unglaublich hohe Geldbeträge im US-amerikanischen Kongress für die Bewaffnung der Mudschahedin freizumachen. Dies kann aus vielen verschiedenen Gründen interessant sein, ist es für mich aber hauptsächlich, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ein Kreis würde sich nachträglich schließen zwischen den stickigen Stätten der indischen Filmindustrie und den kühlen grünen Tälern Afghanistans, die man auf dem Weg dorthin überquert, so man denn von Westen her anreist. Der Teppichboden in der Loge war übrigens fast vom gleichen Rot wie die Polsterbezüge der Air Force One in den 80er Jahren.
Sie fragen sich nun, lieber Leser, was dies wohl mit Schmutz zu tun haben soll, insbesondere mit Schmutz im Film, und Sie stellen sich diese Frage zurecht. Zunächst einmal nämlich gar nichts, es sei denn, man würde die ausgelatschten metaphorischen Pfade betreten wollen, auf denen alles mit allem zu tun hat und beispielsweise ein blitzsauberer flauschiger Teppich in einem indischen Großstadtkino nicht nur als Aufhänger für einen bemühten Diskurs zur Dialektik des Einschließens und Ausschließens, der Abgrenzung und des Einbezugs dienen könnte, sondern zugleich auch noch hinzeigt zu den tausend Plateaus, auf, unter und zwischen denen alle Dinge, Menschen und Ereignisse miteinander verknüpft und verwoben sind. Ein wenig esoterisch, nicht wahr?
Andererseits jedoch tatsächlich auch irgendwie – wahr. Denn der Begriff des Schmutzes hat immer auch mit der Sehnsucht nach Reinheit zu tun. Mit dem Guten und dem Schlechten. Mit dem, was man will und dem, was man nicht will. Der Schmutz ist also zunächst einmal per definitionem das, was nicht zu wollen ist, das Ausgeschlossene, das weg muss und bestimmt somit aber zugleich das Gute, Wahre, Schöne, also eben das, was sehr wohl zu wollen ist und in der Welt sein und auch bleiben soll. Der Begriff, mit dem wir es zu tun haben, ist folglich einer der Ausgrenzung, der zugleich immer auch dialektisch der Bestimmung dessen dient, zu dem er nicht gehören soll. Am Notausgang links sehen wir kurz Michel Foucault winken, bevor er leise den Saal verlässt. Popcorn holen, wahrscheinlich.
[…]
 Es geht also um die Wahl eines Ausschnittes, und schon sind wir beim Prozess der Erstellung eines Filmproduktes. Der primäre Akt des Filmschaffens (und nicht nur des Filmschaffens, sondern natürlich des Kunstschaffens überhaupt) ist nämlich zunächst und immer wieder der der Auswahl. Die Themenwahl des Drehbuchs, das Casting der Schauspieler, die Erstellung des Sets und dann, ganz wichtig – die Bestimmung des Bildausschnittes, in jeder einzelnen Szene neu. Womit wir beim Begriff der Kadrierung sind, oder auch Cadrage (von Französisch le cadre, der Rahmen) der quasi das Paradigma der filmischen Produktion ist, da er die Platzierung von Gegenständen und Personen innerhalb eines Rahmens, der identisch mit der Leinwand ist, beschreibt; oder eben auch die Wahl des Bildausschnittes einer Szene, bei der man die Platzierung nicht selbst bestimmen kann. Das Bildfeld, das vom Bildformat eingeschlossen ist, heißt dann Kader, der Rahmen des Bildausschnitts Kadrierung. Sie sehen, wo das hinführt. Einschluss und Ausschluss, Auswahl und Negierung.
Es geht also um die Wahl eines Ausschnittes, und schon sind wir beim Prozess der Erstellung eines Filmproduktes. Der primäre Akt des Filmschaffens (und nicht nur des Filmschaffens, sondern natürlich des Kunstschaffens überhaupt) ist nämlich zunächst und immer wieder der der Auswahl. Die Themenwahl des Drehbuchs, das Casting der Schauspieler, die Erstellung des Sets und dann, ganz wichtig – die Bestimmung des Bildausschnittes, in jeder einzelnen Szene neu. Womit wir beim Begriff der Kadrierung sind, oder auch Cadrage (von Französisch le cadre, der Rahmen) der quasi das Paradigma der filmischen Produktion ist, da er die Platzierung von Gegenständen und Personen innerhalb eines Rahmens, der identisch mit der Leinwand ist, beschreibt; oder eben auch die Wahl des Bildausschnittes einer Szene, bei der man die Platzierung nicht selbst bestimmen kann. Das Bildfeld, das vom Bildformat eingeschlossen ist, heißt dann Kader, der Rahmen des Bildausschnitts Kadrierung. Sie sehen, wo das hinführt. Einschluss und Ausschluss, Auswahl und Negierung.
Dann aber, in einer Umkehrung all dieses Wählens, passiert unversehens etwas Seltsames – der Schmutz im Kunstprodukt wird nämlich plötzlich gesucht, hergestellt, gemacht. Er verwandelt sich in den seltsam gewollten Zwillingsbruder des alltäglich greif- und auch beseitigbaren Drecks der „wirklichen“ Welt.
Es gibt natürlich auch Glücks- und Unglücksfälle, was Kontrolle und Auswahl angeht, die jedoch dann immer noch, zumindest nachträglich, einem gewissen Maß von Korrigierbarkeit unterliegen, so man sie denn wahrnimmt. Nehmen wir die Sternschnuppe im „Weißen Hai“. Die Szene kurz vor Morgengrauen, nachdem Robert Shaw die Geschichte vom Untergang der Indianapolis erzählt hat, die Drei betrunken in der Kombüse Lieder singen und plötzlich der Hai wieder auftaucht, gegen den Schiffsrumpf stoßend, so dass die Planken zittern. Roy Scheider rennt an Deck, kramt angstvoll seinen Revolver hervor, in Nahaufnahme von unten, am Bug. Sein schreckverzerrtes Gesicht, der Revolver direkt vor der Kameralinse, im Hintergrund schwanken die Bootsaufbauten – und dann zieht von rechts eine Sternschnuppe durchs Bild, quer über den schwarzblauen Himmel, mit gelblich-rotem Schweif, verschwindet hinter Scheiders Kopf. Eine halbe Sekunde vielleicht, dann vorbei. Ist das bemerkt worden? Natürlich, und Spielberg hat diesen Take nehmen müssen, auch wenn er zwanzig andere, bessere gehabt hätte. Er hat ihn nehmen müssen. Während in Herzogs „Kaspar Hauser“ im weiten Naturpanorama ein Auto über die Landstraße fährt, als im Vordergrund der schwarze Mann Kaspar gerade das Gehen beibringen will. 1828.
Doch zurück zu den gewollt konstruierten filmischen Erscheinungen, zum kunstsauberen Zwillingsbruder des Profanschmutzes. Wollte man eine Systematik in die Vorgänge bringen, könnte man, unter Anwendung von ein wenig Gewalt und offizieller Anerkennung diverser Grauzonen, drei Arten von Dreck im Kontext des bewegten Bildes unterscheiden.
 Sinnig wäre es wohl, mit dem tatsächlich materiell sichtbaren Schmutz auf und in den Bildern zu beginnen, nicht also mit der schlechten Qualität von Material oder Handlung, von der natürlich noch zu sprechen ist, sondern mit Kleidern, die in die Waschmaschine gehören und Blut, das auf Kameralinsen spritzt und Matsch und unglaublichen Müllbergen, zwischen denen Krähen umher hüpfen. Dies ist eine sehr simple und direkte Form von Dreck, deren Verweisfunktion keiner großen Erklärung bedarf – es geht fast immer um Authentizität, um das Wahre (Achtung, Umkehrung!), Erdige, um die Erzeugung eines Gefühls der Nähe, der Evidenz, des Mitten-im-Geschehen-Seins. Das wahre Leben im Film also ist zumeist schmutzig, und je mehr man es mit der Simulation von Historie zu tun hat, desto schmutziger wird es. Die völlige, klinische Abwesenheit von Schmutz hingegen ist oftmals Zeichen des Artifiziellen, in die Zukunft Gewandten. Sei es die kategorisch schmutzfreie virtuelle Welt in „Tron“ oder die immens aufgeräumte und schmerzhaft glänzende Optik der jüngsten „Star Trek“-Produktion; die saubersten Filme sind immer Science-Fiction-Filme. Als erwähnte Gegenbeweise und Grauzonen wären beispielsweise Werke wie „Blade Runner“ oder auch „Star Wars“ (Episode IV-VI) anzuführen, in denen die noch dreckigere Zukunft logische Fortsetzung unserer ohnehin schon dreckigen Gegenwart ist. Was jedoch, wie man sich schon hat denken können, dann wiederum unter die bereits angeführte Kategorie der simulierten Authentizität fällt.
Sinnig wäre es wohl, mit dem tatsächlich materiell sichtbaren Schmutz auf und in den Bildern zu beginnen, nicht also mit der schlechten Qualität von Material oder Handlung, von der natürlich noch zu sprechen ist, sondern mit Kleidern, die in die Waschmaschine gehören und Blut, das auf Kameralinsen spritzt und Matsch und unglaublichen Müllbergen, zwischen denen Krähen umher hüpfen. Dies ist eine sehr simple und direkte Form von Dreck, deren Verweisfunktion keiner großen Erklärung bedarf – es geht fast immer um Authentizität, um das Wahre (Achtung, Umkehrung!), Erdige, um die Erzeugung eines Gefühls der Nähe, der Evidenz, des Mitten-im-Geschehen-Seins. Das wahre Leben im Film also ist zumeist schmutzig, und je mehr man es mit der Simulation von Historie zu tun hat, desto schmutziger wird es. Die völlige, klinische Abwesenheit von Schmutz hingegen ist oftmals Zeichen des Artifiziellen, in die Zukunft Gewandten. Sei es die kategorisch schmutzfreie virtuelle Welt in „Tron“ oder die immens aufgeräumte und schmerzhaft glänzende Optik der jüngsten „Star Trek“-Produktion; die saubersten Filme sind immer Science-Fiction-Filme. Als erwähnte Gegenbeweise und Grauzonen wären beispielsweise Werke wie „Blade Runner“ oder auch „Star Wars“ (Episode IV-VI) anzuführen, in denen die noch dreckigere Zukunft logische Fortsetzung unserer ohnehin schon dreckigen Gegenwart ist. Was jedoch, wie man sich schon hat denken können, dann wiederum unter die bereits angeführte Kategorie der simulierten Authentizität fällt.
Die zweite Kategorie ist noch viel mehr eine des Urteilens, des Blickes von Außen. Nennen wir sie „Bewertungsdreck“. Die Betrachtung von Filmwerken nach Qualitätsmerkmalen also. Der Dreck entsteht erst im Urteil über das Werk. Was ist Schund, was ist wertig? Wieder also ein Vorgang der Auswahl im täglich sich neu vermehrenden Wust der Kritik. Was ist ein guter Film, was ein schlechter? Die Beantwortung dieser Frage ist natürlich noch einfach, wenn man es mit ins Bild hängenden Mikrofonen, schlechten Schauspielern und miserablem Filmmaterial selbst zu tun hat, dem Trash-Kino also und seinen diversen Verwandten in Pornografie und Subkultur. Fehlende Qualität im Handwerklichen macht das Urteilen anscheinend simpel, schwieriger wird es jedoch, wenn der Geschmack mitspielen darf. Regeln und Meinungen diesbezüglich sind unendlich und über die ganz eigene Großartigkeit des Underground-Films muss man eigentlich auch nicht viele Worte verlieren.
Noch komplizierter wird es, wenn dann solche Metaschleudern wie Quentin Tarantino daherkommen und das Zeichenrepertoire des Trash-Films zur Grundlage des Reminiszenten machen und bis hin zu computersimulierten Brandlöchern und Filmrissen die Ästhetik des vormals ungewollten und somit camphaften Qualitätsmangels zum Prinzip erhoben wird. Zwar ist allein die Konsequenz dessen schon bewundernswert, jedoch wird das ohnehin bereits angeschlagene Konzept wahrscheinlich nun mit dem im August erscheinenden „Inglourious Basterds“ final umkippen wie ein zu lange in der Sonne stehen gelassener Badesee.
Die dritte Art filmischen Drecks ist wohl die interessanteste, die nämlich des emotionalen Drecks, des Konfliktes also, der jede Erzählung (wir befinden uns also wieder in der Handlung selbst) spannend macht und zumeist auch erst entstehen lässt. Ein ungewolltes Problem tritt in die Leben der Protagonisten ein und muss (auf-)gelöst, beseitigt und somit ausgegrenzt werden, damit ein (gewünscht gutes) Ende zu haben ist. Funktioniert das künstlerische Produkt, so schwappt die erzeugte emotionale Konfliktschmutzigkeit über auf das Publikum, das folglich die Handelnden emphatisch begleitet und somit überhaupt erst an der Auflösung und damit einhergehenden Reinigung teilhaben kann. Katharsis, Sie wissen schon. Manchmal jedoch wird einem diese auch verwehrt, beispielsweise in Gaspard Noés „Menschenfeind“ und „Irréversible“, „Trouble Every Day“ von Claire Denis oder „Ex Drummer“ von Koen Mortier und man schleicht emotional ungereinigt aus dem Kino. Natürlich kann dieses aber auch noch in zweiter Stufe Folgen haben, dann nämlich, wenn das in die „wirkliche Welt“ Mitgenommene weiterarbeitet und vielleicht später erst Effekte zeitigt, wie auch immer selbige aussehen mögen.
Dieser kurze Versuch einer Systematik ist natürlich ebenso nichts weiter als dürftiger Ausschnitt und Auswahl, unglaublich viele Leerstellen produzierend, die wohl bei jedem anders aussehen werden. Die Möglichkeiten und Varianten sind zahllos, und schon allein der diesbezügliche Gedanke an das französische Kino des vergangenen Jahrhunderts müsste viele weitere Seiten füllen. Jedoch ist nun leider der Rahmen voll. Ende. Abspann. Danke.
Erschienen in: OPAK #2 / 2009