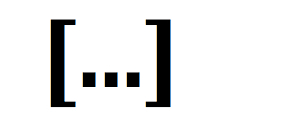Die Beklemmung, die man verspürt, wenn man an einem Freitagnachmittag den Vorplatz des Jerusalemer Busbahnhofs betritt. Jede dritte Person trägt die Uniform der IDF, und alle sind sie auf dem Weg nach Hause, denn der Sabbat steht vor der Türe. Eine jede von ihnen wird am Eingang durch eine gesonderte Türe geschleust, vorbei an den Metalldetektoren. Denn hier bleibt die Waffe nicht in der Kaserne, ein „Dienstfrei“ gibt es nicht, jedenfalls nicht innerhalb der zwei (Frauen) bzw. drei (Männer) Jahre Wehrdienst, die ein jeder Bürger des Staates Israel abzuleisten hat. Das Standardmagazin des M4-Sturmgewehrs fasst 20 Patronen 5,56 x 45 mm NATO-Munition, und an diesem persönlich subjektiven Freitagnachmittag befinden sich in einem Radius von 500 Metern um den Erzähler dieser Geschichte ungefähr 100 M4-Sturmgewehre, durchgeladen und gesichert. Dies macht nach Adam Ries(e) 2000 Patronen 5,56 x 45 mm NATO-Munition; und sollte bei vollem Magazin eine weitere in den Lauf verbracht worden sein, wovon auszugehen ist, so sind 100 weitere hinzuzuzählen. 2100 Patronen 5,56 x 45 mm NATO-Munition an einem beliebigen Freitagnachmittag auf dem Vorplatz des Jerusalemer Busbahnhofs, zwischen Zuckerwatteverkäufern, arabischen Großfamilien, christlich-orthodoxen Priestern, Schulklassen und Reisegruppen – und jeder Finger an jedem Abzug ist bereit zu tun, was zu tun ist, jederzeit und (höchstwahrscheinlich/naturgemäß) frei von Zweifel. Die Beklemmung, die man verspürt, wenn man an einem beliebigen Freitagnachmittag den Vorplatz des Jerusalemer Busbahnhofs betritt, geht nicht weg, wenn man ihn verlässt, sie geht nicht weg, wenn man gegrillten Fisch am Hafen in der Altstadt von Jaffa isst, oder Hummus und Schawarma, begleitet von Limonana, auf einer Dachterrasse nahe der Grabeskirche. Beim Waschen der Wäsche nicht, und nicht beim Sortieren der Bücher. Nicht im Supermarkt und nicht im Museum. Nichts davon geht weg, auch lange nach Verlassen des Landes; und der Erzähler dieser Geschichte ist doch nur jemand, der kurz zu Besuch war und von alledem nicht mehr hat als eine bloße Ahnung.
Ganzen Artikel anzeigenDie beste Position, um all die Strukturen und alltäglichen Kleinigkeiten zu erkennen, die eine Kultur ausmachen und die man selbst innerhalb der selben kaum mehr wahrnimmt, ist paradoxerweise die des Außenseiters. Oder, anders gesagt: die, die am wenigsten zuhause sind in einer Kultur, sind oft diejenigen, die sie am besten beschreiben können.
Dies zeigt auch der dritte Roman der aus Nigeria stammenden Autorin Chimamanda Ngozi Adichie. Denn sie selbst hat, wie ihre Protagonistin Ifemelu, einen Großteil ihres Erwachsenenlebens in den USA verbracht und wurde dort zu einer präzisen Beobachterin besagter Eigenheiten und deren Auswirkungen auf das tägliche Dasein. Insbesondere natürlich, wenn es um den Vergleich rassenspezifischer Hierarchien in den Vereinigten Staaten mit den sozialen Gegebenheiten in ihrem Heimatland geht. Dies geschieht mit schonungsloser Offenheit, was sowohl die schönen wie auch die hässlichen Aspekte beider Nationen betrifft.
Americanah verhandelt dieses Beobachten anhand der Geschichte von Ifemelu und Obinze, die als Jugendliche ein Liebespaar waren. Die beiden Kinder der englischsprachigen gehobenen Mittelschicht Nigerias verlieben sich als Teenager ineinander; als Ifemelu jedoch ein Studium in den USA beginnt, trennen sich ihre Wege. Ebenso wie die Autorin gehört ihre Protagonistin zu einem neuen Typ von Migranten, die nicht einer sozialen Notsituation entfliehen müssen, sondern „gut genährt und bewässert, aber steckengeblieben in Unzufriedenheit“ sind und „der unterdrückenden Lethargie der Perspektivlosigkeit“ entkommen wollen.
Dies scheint auch, zumindest für Ifemelu, gut zu funktionieren. Sie erhält (ebenfalls eine Gemeinsamkeit mit der Autorin) ein Stipendium in Princeton, etabliert sich im akademischen Betrieb und führt eine Beziehung mit einem Yale-Professor. Dass sie dabei jedoch die Sehnsucht nach ihrer Heimat nie ablegen kann, liegt auch daran, dass sie sich in gewisser Weise in eine andere verwandelt hat, seit sie Lagos verließ: nämlich in eine Schwarze. In Nigeria hatte sie das nie gespürt.
[…]
Ganzen Artikel anzeigenEin Versuch über Schmutz und Film
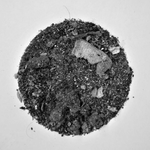 Der dickste Teppich, in dem meine Füße jemals versanken, befindet sich im Logenbereich des Sathyam Cinemas in Chennai. Der Regisseur K. Hariharan, mit dem ich in jenen Tagen viel Zeit in einem viel zu kalten Schneideraum verbrachte, nur unterbrochen von gelegentlicher Suppe und Samosas in der Studioküche, hatte uns zur Premiere von Om Puris neuestem Film, „The Hangman“, eingeladen. In diesem spielt er, worauf der Titel bereits dezent verweist, einen Henker, der im dramatischen Verlauf der fast dreistündigen Handlung seinen einzigen Sohn an die illegalen Verlockungen der Großstadt verliert und am Ende tatsächlich vom Lande her anreisen muss, um selbigen zu hängen, durch den obersten Richter persönlich gerufen, da er der Letzte und Beste seiner Zunft ist. Es wurde jedoch nicht gesungen. Warum fällt mir das gerade jetzt wieder ein? Wahrscheinlich, weil ich kürzlich „Charlie Wilson’s War“ sah, und auch Om Puri wieder, der dort General Muhammad Zia-ul-Haq verkörpert, seines Zeichens Staatsoberhaupt Pakistans von 1977 bis 1988 und emotionaler Joker in Joanne Herrings antikommunistischem Unterfangen, via den texanischen Abgeordneten Charles Nesbitt Wilson unglaublich hohe Geldbeträge im US-amerikanischen Kongress für die Bewaffnung der Mudschahedin freizumachen. Dies kann aus vielen verschiedenen Gründen interessant sein, ist es für mich aber hauptsächlich, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ein Kreis würde sich nachträglich schließen zwischen den stickigen Stätten der indischen Filmindustrie und den kühlen grünen Tälern Afghanistans, die man auf dem Weg dorthin überquert, so man denn von Westen her anreist. Der Teppichboden in der Loge war übrigens fast vom gleichen Rot wie die Polsterbezüge der Air Force One in den 80er Jahren.
Der dickste Teppich, in dem meine Füße jemals versanken, befindet sich im Logenbereich des Sathyam Cinemas in Chennai. Der Regisseur K. Hariharan, mit dem ich in jenen Tagen viel Zeit in einem viel zu kalten Schneideraum verbrachte, nur unterbrochen von gelegentlicher Suppe und Samosas in der Studioküche, hatte uns zur Premiere von Om Puris neuestem Film, „The Hangman“, eingeladen. In diesem spielt er, worauf der Titel bereits dezent verweist, einen Henker, der im dramatischen Verlauf der fast dreistündigen Handlung seinen einzigen Sohn an die illegalen Verlockungen der Großstadt verliert und am Ende tatsächlich vom Lande her anreisen muss, um selbigen zu hängen, durch den obersten Richter persönlich gerufen, da er der Letzte und Beste seiner Zunft ist. Es wurde jedoch nicht gesungen. Warum fällt mir das gerade jetzt wieder ein? Wahrscheinlich, weil ich kürzlich „Charlie Wilson’s War“ sah, und auch Om Puri wieder, der dort General Muhammad Zia-ul-Haq verkörpert, seines Zeichens Staatsoberhaupt Pakistans von 1977 bis 1988 und emotionaler Joker in Joanne Herrings antikommunistischem Unterfangen, via den texanischen Abgeordneten Charles Nesbitt Wilson unglaublich hohe Geldbeträge im US-amerikanischen Kongress für die Bewaffnung der Mudschahedin freizumachen. Dies kann aus vielen verschiedenen Gründen interessant sein, ist es für mich aber hauptsächlich, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ein Kreis würde sich nachträglich schließen zwischen den stickigen Stätten der indischen Filmindustrie und den kühlen grünen Tälern Afghanistans, die man auf dem Weg dorthin überquert, so man denn von Westen her anreist. Der Teppichboden in der Loge war übrigens fast vom gleichen Rot wie die Polsterbezüge der Air Force One in den 80er Jahren.
Sie fragen sich nun, lieber Leser, was dies wohl mit Schmutz zu tun haben soll, insbesondere mit Schmutz im Film, und Sie stellen sich diese Frage zurecht. Zunächst einmal nämlich gar nichts, es sei denn, man würde die ausgelatschten metaphorischen Pfade betreten wollen, auf denen alles mit allem zu tun hat und beispielsweise ein blitzsauberer flauschiger Teppich in einem indischen Großstadtkino nicht nur als Aufhänger für einen bemühten Diskurs zur Dialektik des Einschließens und Ausschließens, der Abgrenzung und des Einbezugs dienen könnte, sondern zugleich auch noch hinzeigt zu den tausend Plateaus, auf, unter und zwischen denen alle Dinge, Menschen und Ereignisse miteinander verknüpft und verwoben sind. Ein wenig esoterisch, nicht wahr?
Andererseits jedoch tatsächlich auch irgendwie – wahr. Denn der Begriff des Schmutzes hat immer auch mit der Sehnsucht nach Reinheit zu tun. Mit dem Guten und dem Schlechten. Mit dem, was man will und dem, was man nicht will. Der Schmutz ist also zunächst einmal per definitionem das, was nicht zu wollen ist, das Ausgeschlossene, das weg muss und bestimmt somit aber zugleich das Gute, Wahre, Schöne, also eben das, was sehr wohl zu wollen ist und in der Welt sein und auch bleiben soll. Der Begriff, mit dem wir es zu tun haben, ist folglich einer der Ausgrenzung, der zugleich immer auch dialektisch der Bestimmung dessen dient, zu dem er nicht gehören soll. Am Notausgang links sehen wir kurz Michel Foucault winken, bevor er leise den Saal verlässt. Popcorn holen, wahrscheinlich.
[…]
Ganzen Artikel anzeigen