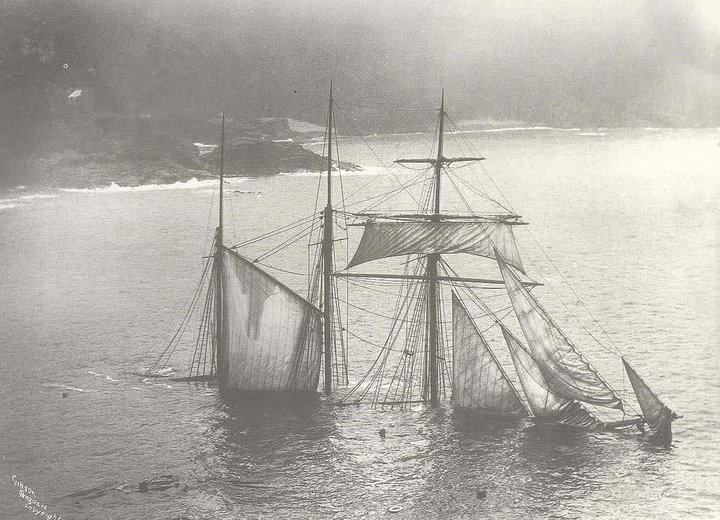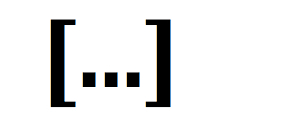Bei dem Wort Syriana handelt es sich um einen US-amerikanischen Fachbegriff für eine mögliche Umstrukturierung des Nahen Ostens nach westlichem Vorbild, mit deren Ausarbeitung sich Organisationen wie das Komitee zur Befreiung des Irak beschäftigen, welches sich im Film in das (fiktive) Komitee zur Befreiung des Iran verwandelt und natürlich keinen anderen Zweck hat als die nötigen Bedingungen zu schaffen, um mögliche Märkte für die US-Wirtschaft zu erschließen.
Stephen Gaghan, Drehbuchautor von Traffic und Regisseur von Syriana, stieß bei Recherchen für erstgenanntes Werk immer wieder auf bemerkenswerte und auch bemerkenswert unverdeckte Verquickungen von Energiefirmen und Regierungsmitarbeitern. Zur künstlerischen Bearbeitung dieser offenen Geheimnisse fehlte jedoch noch eine dramatische Grundlage. Diese war gefunden, als Gaghan auf die Memoiren des Ex-CIA-Agenten Robert Baer stieß, der im Film von George Clooney dargestellt wird.
Mit dieser Basis und dem Handelsgut Öl als schwarz glänzendem Faden erzählt Syriana drei große und viele kleine Geschichten, die alle mit dem gleichen zu tun haben. Es geht um Macht und deren Gegenteil, um Ausbeutung und Maßlosigkeit und natürlich um Korruption. Diese sorgt dafür, dass der Wohlstand der westlichen und insbesondere US-amerikanischen Welt gesichert ist und auch bleibt.
[…]
Ganzen Artikel anzeigen