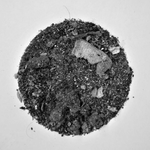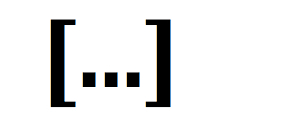Durch das Fenster des Flugzeuges sah man die uralten Länder sich ausbreiten, unter deren Sand kein Königreich mehr zu finden ist. Die milchigen, hellblauen Seen zwischen Quadratkilometern gelben und braunen Ödlandes, unter deren Oberfläche die Strömung Muster in den sandigen Grund zeichnet, Richtungsfelder, die nur von oben zu sehen sind, große Pfeile ohne Magnet. Auf den dunkleren Bergzügen weitläufige, sich verästelnde Wege, kleine Siedlungen miteinander verbindend oder ins Nichts führend, verschwindend in dunklen Schluchten oder in der sich plötzlich auftuenden Weite der großen Wüste. Später die kühlen, grünen Täler, Rücken riesiger, ewig schlafender Tiere, in Granit gekauert. Dann Nacht, der ausglimmenden Dämmerung in 10.000 Meter Höhe folgend, am gekrümmten Schnittpunkt zwischen Atmosphäre und Unendlichkeit.
Ich verließ die Abfertigungshalle in der Nacht und sowohl der Fahrer als auch sein Assistent hatten nicht mehr als eine ungefähre Ahnung von dem Ort, an den ich zu bringen sei. So fuhren wir lange Stunden durch die leeren staubigen Straßen, an vereinzelten Polizisten vorbei, die in verschiedene Richtungen wiesen, um schließlich doch, durch Zufall natürlich, das zurückgesetzte dunkle Haus zu finden, hinter bewachsenen Mauern, umschmiegt von großen Bäumen. Am Nachbargebäude zierten große goldene Swastiken die Balkone, glitzernd im schwankenden Licht der Laternen.
Das Appartement teile ich mir mit einem Mädchen nie gehörten Namens. Ich sitze in dem unglaublich großen Wohnzimmer an einem viel zu kleinen Sekretär, auf einem viel zu niedrigen Stuhl. Durch die vergitterten, weiß gestrichenen Fenster ragen beinahe die Palmen herein; zwischen angegilbten Zweigen die Straße, überflutet von braunem Wasser. An der Toreinfahrt stehen ratlose Frauen, die Hände an den Säumen ihrer Saris, unentschlossen, die Fluten zu durchqueren. Ein grauhaariger Mann steigt auf sein Fahrrad und fährt zum trockenen Mittelstreifen. Hinten, in der Küche, verkocht der Reis und rechts singt Thom Yorke aus kleinen schwarzen Boxen. Auf dem Sekretär steht ein illustrierter Abreißkalender, der auf gelblichem Grund zwei verschiedenartige Hunde und einen angeschnittenen Gugelhupf zeigt. Durch die Bäume huschen Eichhörnchen, die wie Ratten aussehen. Ratten mit buschigem Schwanz.
In einer Schublade fand ich ein Photo, auf dem ist eine hübsche Amerikanerin zu sehen. Sie sitzt auf einem Bett, in einem chinesischen Hotelzimmer. Ich weiß, wo dieses Hotel steht, kenne seine Betten und Webstoffe, die bronzenen Armaturen, mit denen nichts mehr zu regeln ist, kein Radio und keine Lüftung, kenne die Treppenhäuser und den kleinen Raum der Etagenwächterin, die Plastikbehältnisse und die gelblich schimmernden Wäschehaufen, kenne die Blicke aus den Fenstern, den metallenen Handwagen und das Fleisch, das er trägt, den Rauch, der sich meterhoch in die selten kalten Nächte erhebt, noch weit hinaus über die Bäume und Gebäude, wie ein großer weißer Vorschlag, wie ein unbefangener Gruß. Ich weiß, dass man nicht weit gehen muss, den See zu sehen. Die farbigen Neongründe, in die er sich schon zur Dämmerung hüllt, sind mir wohl bekannt. Sie spricht die Sprache des Landes, die hübsche Amerikanerin, und bestimmt sind ihre Fußsohlen weich wie Hasenfell, ihre Zähne scharf wie Zollkontrollen. Wie ein dunkler Gedanke verspürte ich den Wunsch, mit ihr auf den Grund der tiefsten Schlucht des Landes zu stoßen, weitab der geführten Gruppen und der Plastikstühle. Die Zungen der Schweine schmecken sehr gut, in diesem Teil des Staates.
[…]
Ganzen Artikel anzeigen